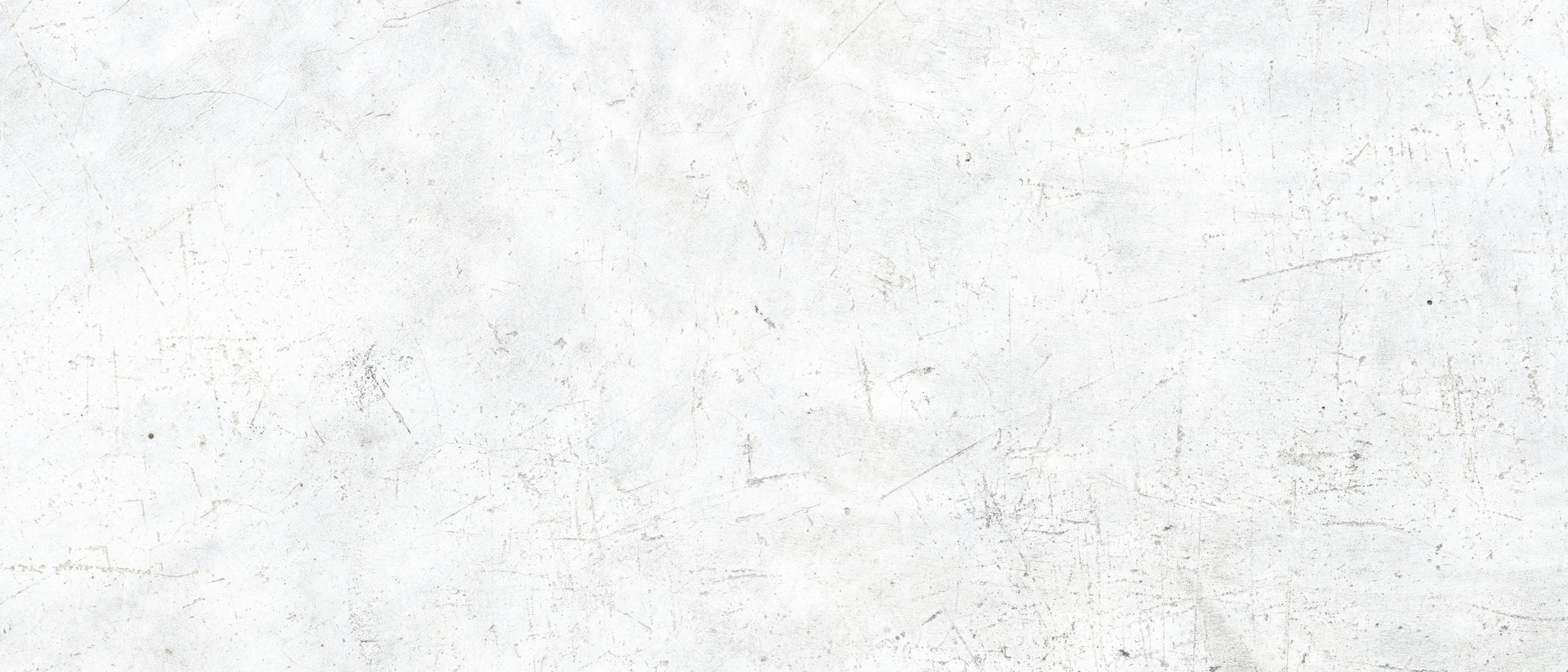Problemzone Zink

Zink gilt als schwieriger Stoff für Beschichtungen. Ist die Untergrundvorbereitung auf das Material abgestimmt und es werden dafür geeignete Beschichtungen verarbeitet, sinkt das Schadensrisiko erheblich. Problematisch können die Korrosionsprodukte des Zinks, der Weißrost, werden. Rost verursacht jedes Jahr hohe Kosten bei der Instandhaltung von Bauwerken und z. B. Fahrzeugen. Deshalb hat sich die Verzinkung von Eisenmetallen durchgesetzt. Oft bleiben diese Oberflächen ohne weitere Beschichtungen über Jahrzehnte ohne Schaden. In vielen Fällen ist jedoch eine Beschichtung vorhanden oder wird gewünscht. Dann muss man genau kontrollieren. Schutz durch Zinkpatina Zink korrodiert, wie praktisch alle anderen Metalle auch, allerdings erfolgt der Vorgang sehr langsam. Korrosionsschutz von Eisenmetallen durch Zink – wie auch der Schutz für die Zinkoberfläche selbst – ist daher eine Frage der Ausbildung dichter, festhaftender dunkelgrauer Zink-Deckschichten. Diese übernehmen die Funktion einer Schutzschicht, die man auch als Zinkpatina bezeichnet. Die Patina bewahrt das darunter liegende Zink vor weiteren Korrosionsangriffen.
Das Problem Weißrost
Die für die Korrosionsschutzwirkung des Zinks so wichtigen Deckschichten entstehen innerhalb eines längeren Zeitraums nach der Verzinkung. Sie können sich jedoch nicht ausbilden, wenn die Zinkoberfläche über einen längeren Zeitraum mit Wasser benetzt ist, das keine oder nur sehr wenig mineralische Stoffe enthält. Der Vorgang wird ebenfalls behindert, wenn der Luftzutritt und damit das CO2-Angebot unzureichend ist. Stattdessen bildet sich auf der Oberfläche in kurzer Zeit ein meist weiß-graues Zinkkorrosionsprodukt, der so genannte Weißrost. Als Weißrost bezeichnet man alle Korrosionsprodukte des Zinks, die als weißgraue Flecken auftreten. In der Praxis wird Weißrost meist bei frisch verzinkten und nicht bei bewitterten Teilen zum Problem.
Ursachenforschung
Zeiträume, in denen Weißrost vermehrt auftritt, sind Herbst und Winter, denn häufiger Niederschlag, Nebel und Taupunktunterschreitungen durch niedrige Temperaturen fördern die Weißrostbildung. Der Maler wird häufig mit Weißrost konfrontiert, wenn er Zinkfensterbänke zum Schutz derselben im Zug von Malerarbeiten abgeklebt und sich dann unter der Schutzfolie Feuchtigkeit ansammelt. Obwohl gut gemeint, bringt auch das Abdecken von im Freien gelagerten verzinkten Stahlteilen mit Planen oder Folien oft mehr Schaden als Nutzen. Die Bildung von Weißrost steht nicht im Zusammenhang mit dem Verzinkungsverfahren und ist kein Maßstab für die Güte der Verzinkung. Es ist vielmehr eine Erscheinung, die ganz wesentlich von den Witterungs- und Umgebungsbedingungen von frisch feuerverzinkten Teilen abhängig ist. Die Schädigung durch Weißrost wird von Laien häufig überschätzt, da bei der Bildung von Weißrost bereits geringe Mengen metallischen Zinks bei ihrer Umsetzung große Mengen des lockeren, amorphen, pulverigen Weißrosts ergeben.

Problem lösen
Geringe Mengen an Weißrost werden nach Fortfall der auslösenden Bedingungen in eine das Zink schützende Deckschicht umgewandelt. In Bezug auf die Bewertung der optischen Beeinträchtigung ist grundsätzlich zu bedenken, dass sich der zunächst vorhandene silbrige Glanz ohnehin im Verlauf einiger Monate verliert und sich sukzessiv in einen hellen Grauton verwandelt. Im Zug dieses natürlichen Alterungsprozesses egalisieren sich diese weißgrauen Verfärbungen oftmals nahezu vollständig. Sind die Bedingungen, die die Weißrostbildung ausgelöst haben, nicht mehr vorhanden, breitet er sich auch nicht weiter aus. Bei geringem Weißrostbefall ist daher regelmäßig eine Entfernung des dünnen, weißgrauen Belags aus technischer Sicht nicht erforderlich; die Korrosionsprodukte lagern sich vielmehr in die sich langsam bildende Deckschicht ein. Ist jedoch eine zusätzliche Beschichtung vorgesehen, muss man den Weißrostbelag entfernen, da andernfalls das Haftvermögen der Beschichtung beeinträchtigt würde. Die Entfernung kann beispielsweise mittels einer Edelstahlbürste oder eines nichtmetallhaltigen Schwamms erfolgen, darüber hinaus können auch ammoniakalische Zinkreiniger eingesetzt werden. Die ammoniakalische Netzmittelwäsche hat sich als sehr gutes Verfahren zur Untergrundvorbereitung bei verzinkten Untergründen bewährt. Nach der Entfernung ist die Zinkoberfläche an den befallenen Stellen etwas dunkler. Dieser farbliche Unterschied gleicht sich im Lauf der Zeit jedoch an.
Auswirkungen auf die Zinkschicht
Starke Weißrostbildung tritt vor allem bei andauernder und intensiver Befeuchtung auf. Sie kann zu einer erheblichen Schädigung des Zinküberzugs, bis hin zu einer lokalen Zerstörung führen. Eine objektive Aussage über den Umfang einer Schädigung wird in erster Linie durch Messung der noch vorhandenen Zinküberzugsdicke möglich. Ob Ausbesserungen in der Zinkschicht erforderlich sind, hängt vom Ausmaß der Schädigung ab. Sofern die Dicke des Zinküberzuges die nach der Norm geforderten Mindestwerte noch einhält, kann man sich in der Regel mit der Beseitigung des Weißrostes begnügen.