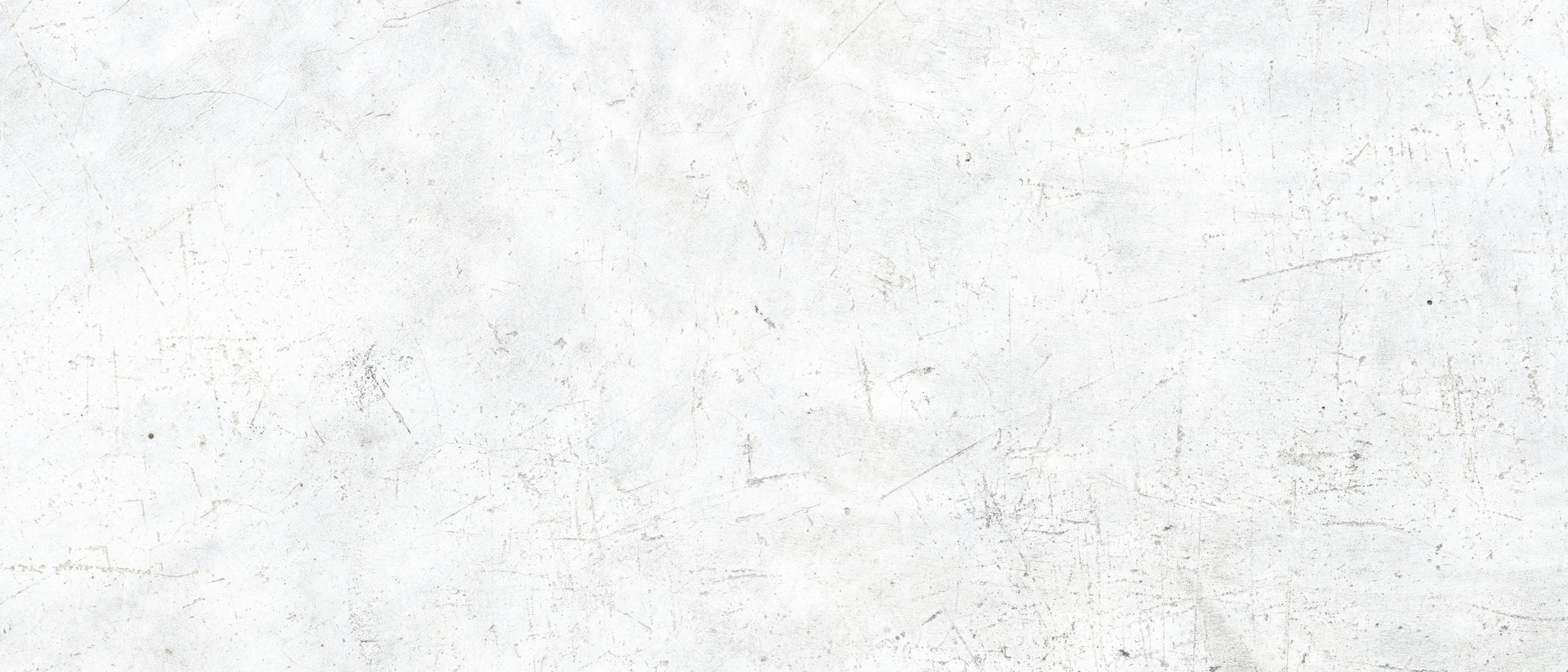Weniger hilft mehr

Naturfarben-Experte Michael Meißner rät: »Wer regelmäßig ein paar Minuten investiert, die Fensterrahmen begutachtet und verwitterte Stellen mit natürlichem Pflegeöl behandelt, kann einen aufwendigen Renovierungsanstrich mitunter Jahre hinausschieben.« Die Pflegebehandlung trägt maßgeblich zum Werterhalt und zur Langlebigkeit der Fenster bei. Der Zeitaufwand beträgt nur fünf bis sechs Minuten pro Fenster.
Dafür müssen zunächst die Holzrahmen mit einer hochwertigen Olivenölseife gereinigt werden. Herkömmliche Reiniger wie Spülmittel entfernen den von der Witterung eingefressenen Schmutz nicht effizient. Im zweiten Schritt wird das aus Lein- und Standöl bestehende Pflegeprodukt mit einem weichen Lappen sehr dünn auftragen und nach rund 15 Minuten auspoliert. Die Leinölbestandteile dringen tief ins Holz ein und frischen die ausgebleichten Farbpigmente auf. Das Standöl sorgt für einen dauerhaften Oberflächenschutz.
Wenig Öl, viel Effekt
Wichtig ist, das Pflegeöl nur auf die verwitterten Stellen aufzutragen, frei nach dem Motto »weniger hilft mehr«. Ein Auftragen auf intakte Holzbereiche hat keinerlei Nutzen, sondern kann sogar eine klebrige, stark glänzende Oberfläche hinterlassen.
Wer seine Fensterrahmen in Schuss halten will, ist für gewöhnlich mit dem Fensterpflege-Set von Kreidezeit reichlich ausgestattet. Ein Set besteht ausschließlich aus ökologischen Zutaten, die vollständig deklariert sind. Es enthält jeweils 100 Milliliter Olivenölseife und Pflegeöl und reicht für circa fünf Quadratmeter. Für großflächigere Anwendungen – beispielsweise zur Pflege von Fachwerk oder Spielgeräten – sind die Komponenten auch einzeln und in größeren Gebinden erhältlich.
Quelle: Kreidezeit Naturfarben / Delia Roscher